“Die lieblichste Flotte von Insel, die jemals in einem Ozean vor Anker ging,” schrieb Mark Twain über die Hawaii-Inseln, auf denen er 1866 mehrere Monate lang als Reporter arbeitete. Obwohl sich der 50. Bundesstaat der USA mit inzwischen mehr als sieben Millionen Besuchern jährlich zum beliebtesten Ferienziel im Pazifik entwickelt hat, konnte er seine natürliche Schönheit bewahren…”
Das Lob des Reiseführers noch im Kopf, reibe ich mir nach mehr als 17 Stunden Flug erstaunt die Augen: Schwarzgraue Regenwolken kleben an den zackig grünen Berghängen, ein Regenbogen überspannt die Hochhäuser aus Glas und Stahl. Unter mir: Ölbunker, Raffinerien, Container. – Der Anflug auf Honolulu läßt meine Träumereien vom Südseeparadies Hawaii wie eine Seifenblase zerplatzen.
Am Flughafen verteilt James “Bernie” Bernholz seine Visitenkarten. “One shot, one kill,” wirbt der Sergeant darauf für seinen privaten Sicherheitsdienst, lukrativer als der Lohn bei der US Army.
Wenige Meter weiter begrüßen zierliche Polynesierinnen in grünen Baströcken eine Reisegruppe. Die vollschlanken, nicht immer ganz jungen Südsee-Schönheiten recken sich bis auf die Zehenspitzen, um die gelben Blumenketten den groß gewachsenen Gästen aus Europa, Japan und vom Festland der USA umzulegen, die ihre Hälse erwartungsvoll entgegenstrecken. “Aloha”, wünschen sie, willkommen auf Hawaii.

Jedes Klischee vom kommerzialisierten Ferienparadies Hawaii findet seinen unerwarteten Kontrast im Alltag des Archipels. Auf dem Highway wird gefrühstückt: Den Kaffeebecher, ein fettiges Muffin-Brötchen oder ein Sandwich in der Hand, drängeln sich die Fahrer der Trucks, Busse, Laster und Limousinen Richtung Waikiki.
Im Traumziel der Tourismusstrategen, in den 60er Jahren auf dem Reißbrett erdacht und auf einst unwirtlichen Sumpfland erbaut, ragen Hochhäuser dicht an dicht in den Himmel, bummeln Gigolos mit Goldkettchen und Sunnyboys mit Surfbrett am Strand entlang. Über ihnen warnen alle paar Meter Solar-Uhren digital: sieben Minuten bis zum Sonnenbrand.
Perfektion am Tag, Idylle am Abend. Während die Kapelle “Red Sails in the Sunset” intoniert, weißbefrackte Ober auf den Strandterrassen die ersten Cocktails servieren , starren alle Augenpaare in eine Richtung: auf das Farben-Feuer des Sonnenunterganges, des grandiosen Finales jeden Urlaubstages auf Hawaii.
Im Garten der “Pink Lady”, des Royal Hawaiian Hotels, gart langsam ein Schwein in der “Imu”, einer mit Lavagestein und Kiawe-Holz ausgelegten Erdgrube. Frauen in Mumuus, langen, wallenden Baumwollgewändern, bereiten gemeinsam das Gemüse vor. Sobald die Sonne im Meer versunken ist, beginnt hier ein “Luau”. Der Eintritt zum polynesischen Festgelage: 99 Dollar.

Mehr Authentizität im Kochtopf strebt Maître Peter Merriman an. Zusammen mit elf Spitzenköchen der Nachbarinseln gründete der Österreicher den Verband “Hawaiian Regional Cuisine”. Seitdem werden alle Zutaten nicht mehr bei den großen Lebensmittelkonzernen gekauft, sondern frisch von einheimischen Bauern, Kleinbetrieben und Kooperativen. Die Rückbesinnung auf die Regionalküche trifft den Zeitgeist: Hawaii entdeckt seine Wurzeln.
Und denkt dabei – ganz amerikanisch – gleich wieder an die profitable Vermarktung. Passend zur Weihnachtszeit erschien im Dezember 1993 mit “Hawaii Regional Cuisine” das erste gemeinsame Kochbuch der zwölf Spitzenköche. Die Gewinne aus dem Verkauf des Buches gehen an Wohlfahrtsverbände.
4000 Kilometer vom nächsten Festland entfernt, ist das Gefühl für den gesellschaftlichen Konsens, das Muss zum Miteinander, besonders ausgeprägt. Der Inselstaat Hawaii ist einer der kosmopolitischsten Regionen der Vereinigten Staaten, ist noch heute ein “melting pot”, ein Schmelztiegel der Rassen. Wehe dem, der einmal einen Hawaiianer nach seiner Herkunft fragt.
Er wird mit einer langen Ahnenreihe unterschiedlichster Nationalitäten antworten. Nachfahren der Einwanderer aus Japan, Portugal, China, den Philippinen und einem Dutzend anderer Nationen leben hier. 25 Prozent der Bevölkerung sprechen eine andere Sprache als die Amtssprache Englisch. Minoritäten-Probleme sind jedoch kaum bekannt. Keine Volksgruppe fühlt sich als Minderheit. Keine ethnische Gruppe stellt mehr als ein Viertel der Bevölkerung. Die Toleranz untereinander ist daher unerwartet groß.

Bindeglied der multikulturellen Vielfalt ist der Hula. Der Tanz des alten Hawaiis, dessen Wurzeln in Mexiko liegen, war ursprünglich den Männern vorbehalten. Der traditionelle “Hula Kahiko” war Teil der Götterverehrung im Tempel. Die Priester (Kahunas) sangen “Meles”, einfache Melodien, die – gleich Mantras – in ihrer monotonen Wiederholung eine fast hypnotische Wirkung hatten, Trancen hervorriefen – und so “göttliche” Ekstasen bewirkten. Die ersten christlichen Missionare, die um 1820 auf Hawaii eintrafen, sahen mit Entsetzen, wie halbnackte Männer im Tempel tanzten.
Der Hula, totgeglaubt als Touristenkitsch, erlebt seit Mitte der 70er-Jahre eine unerwartete Renaissance. Auf dem Rase des Hulihee-Palastes in Kona/Big Island proben junge Mädchen den Hula; ein Blondschopf im gelben Baumwollrock, eine Chinesin mit Orchidee mit dunklen Haar. Die Knie angewinkelt, die Arme seitlich, die Füße fest am Fleck, und nun das Becken wiegen, mit Händen und Augen Geschichten erzählen, immer angetrieben vom Rhythmus der Trommeln und Kastagnetten aus Stein. Nach einer Stunde fallen die Mädchen todmüde ins Gras, Schweißperlen auf der Stirn.

Den Hula als Wurzel der eigenen Identität entdecken, diese Aufgabe hat sich auch Pat Namaka Bacon gesetzt. Seit mehr als 40 Jahren sammelt und katalogisiert “Aunty Pat” im Auftrag des Bishop Museum Honolulu Hula-Tänze und Gesänge. Finanziell unterstützt vom Native Hawaiian Culture and Art Program, baut Namaka Bacon in mühevoller Recherche einen Datendienst auf, der später als on-line-service der University of Hawaii der State Public Library und dem Bishop Museum zugänglich gemacht werden soll – High-tech für den Hula.
Zurück in die Zukunft: Die eigene Tradition entdecken, innovative Technologien ins Land holen, ohne die natürlichen Lebensgrundlagen zu zerstören und den Tourismus als umsatzstärksten Wirtschaftsfaktor ausbauen – diese Philosophie, auf Plakatwänden mit poppigen Parolen propagiert, sollen dem Inselstaat auch im nächsten Jahrtausend noch paradiesische Umsatzzahlen bescheren.
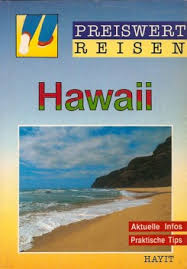
Diese Beitrag ist 1994 in den Lübecker Nachrichten, 2001 in aktualisierter Form auf Spiegel Online erschienen. Über die Inselwelt im Pazifik verfasst ich auch den Preiswert-Reisen-Führer “Hawaii” aus dem Hayit-Verlag Köln.